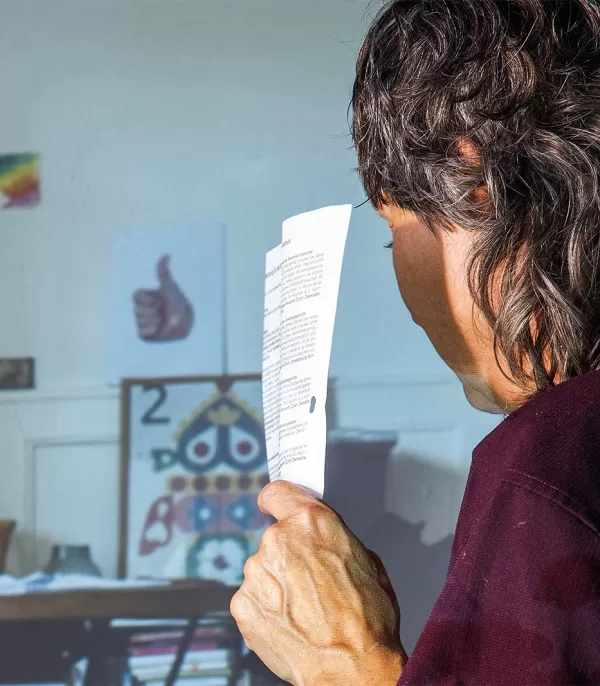Wie fehlende Bildung mit Armut zusammenhängt
7. April 2025 | 3 min. Lesezeit

Bildung gilt als Schlüssel zur Armutsprävention. Doch Kinder aus bescheidenen Verhältnissen haben von Geburt an eingeschränkte Chancen. Fehlen ihnen später die nötigen Qualifikationen und Kompetenzen, droht ein Leben in Prekarität – ein Teufelskreis.
Die soziale Herkunft prägt die Bildungsbiografie massgeblich, wie die neue ländervergleichende OECD-Studie zu den Kompetenzen von Erwachsenen zeigt. In kaum einem anderen Land ist dieser Zusammenhang so deutlich wie in der Schweiz. Woher kommt das?
Kinder aus benachteiligten Familien sind belastenden Lebensumständen ausgesetzt, die ihre Entwicklung hemmen. Schlechte Wohnverhältnisse bieten wenig Raum zum Entdecken. Das knappe Budget reicht zudem kaum für Freizeitaktivitäten oder Nachhilfekurse. Ihre Eltern haben auch oft keine Kapazität, ihre Kinder gezielt zu fördern und beim Lernen zu unterstützen. Sie müssen ihre Ressourcen auf die Alltagsbewältigung richten. Besonders Alleinerziehende sind auf die Existenzsicherung fokussiert und zeitlich überlastet.
Das Einkommen der Eltern beeinflusst die Bildungslaufbahn der Kinder
Die Chancen sind bereits in der Kindheit ungleich. Kinder aus benachteiligten Familien gehen seltener in die Kita als Kinder aus privilegiertem Elternhaus, obwohl sie besonders von der Förderung der Sprach- und Sozialkompetenzen profitieren würden. Das hängt massgeblich mit den hohen Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung zusammen. So bestehen schon beim Kindergarteneintritt unterschiedliche Startvoraussetzungen. Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe verfestigt diese Ungleichheiten.
Wer wenig Geld hat, kann seine Bildungswünsche oft nicht mit der eigenen Lebensrealität vereinbaren.
Auch wenn sie gute Schulleistungen erzielen, besuchen Kinder aus armutsbetroffenen Familien häufiger das niedrigere Schulniveau. Sei es, weil Lehrpersonen ihnen weniger zutrauen oder weil die Eltern das System zu wenig kennen. Damit ist die Bildungslaufbahn weitgehend vorbestimmt: Die Lehrpläne in den Leistungsniveaus der Sekundarstufe unterscheiden sich deutlich und die Schulklassen sind oftmals nicht niveaudurchmischt. Dies erschwert die Durchlässigkeit. Benachteiligte Jugendliche haben zudem eher Mühe, nach dem obligatorischen Schulabschluss eine Ausbildung abzuschliessen.
Lernen fürs Leben: Ein Luxus?
Wenn Qualifikationen und Grundkompetenzen fehlen, erschwert dies später den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu gesellschaftlichen Aktivitäten. Weil die Anforderungen im Alltag und Beruf steigen, ist lebenslanges Lernen unerlässlich, um nicht den Anschluss zu verlieren. Erwachsenen mit geringer Bildung bleibt dies aber oft versperrt.
Wer wenig Geld hat, kann seine Bildungswünsche oft nicht mit der eigenen Lebensrealität vereinbaren: Die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen, lange Arbeitszeiten, unregelmässige Schichten aber auch psychische Belastungen lassen keinen Raum für Weiterbildungen. Und das Einkommen aus einem Niedriglohnjob reicht kaum für den Lebensunterhalt, eine Reduktion des Arbeitspensums ist schlicht unmöglich.
Wenn Qualifikationen und Grundkompetenzen fehlen, erschwert dies später den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu gesellschaftlichen Aktivitäten.
Die Bildungsangebote sind zu wenig auf Armutsbetroffene abgestimmt und Arbeitgeber unterstützen sie nicht ausreichend. Stipendien für Erwachsene gibt es kaum und wenn, dann decken sie meist weder den Lebensunterhalt noch Kinderbetreuungskosten. Dabei wäre genau das zentral, um den Zugang zu Bildung und damit den Weg aus der Armut zu ermöglichen.
Wege aus der Bildungsarmut mit den Unterstützungsangeboten von Caritas
Die Erwartungen an die Eltern sind gross. Doch viele fühlen sich unsicher bei schulischen Themen, wenn sie das Schulsystem nicht kennen, die deutsche Sprache nicht beherrschen oder keine Zeit haben. Hier unterstützen die Angebote von Caritas.

Dieser Artikel erschien im «Caritas regional». Das Magazin der regionalen Caritas-Organisationen erscheint zweimal jährlich.
Jetzt reinlesen!
Zur neusten Ausgabe