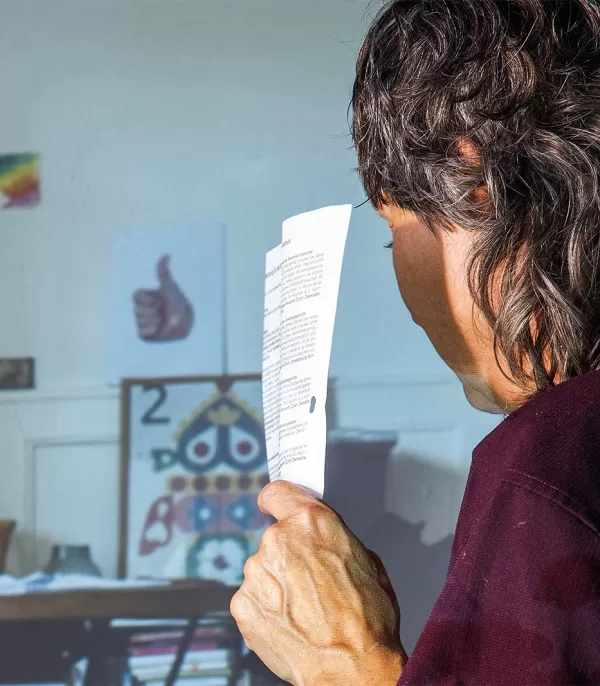Es gibt Auswege aus der Schuldenspirale
6. Oktober 2025 | 4 min. Lesezeit

Heute haben überschuldete Menschen wenig Chancen, ihre Schulden loszuwerden. Diese Perspektivlosigkeit schadet nicht nur den Betroffenen, sondern kommt auch die Allgemeinheit teuer zu stehen. Dabei gäbe es gute Lösungen.
Mit Hypotheken und Krediten ist Verschuldung ein integrativer Teil unseres Wirtschaftssystems. Ohne Schulden würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren, doch gleichzeitig ist Überschuldung eines der grössten Tabus unserer Gesellschaft. Über Geld spricht man nicht, über Schulden schon gar nicht.
So erstaunt es nicht, dass verschuldete Privatpersonen oft Jahre warten, bis sie Unterstützung suchen: Bei den Schuldenberatungsstellen sind 40% der Ratsuchenden zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme schon mehr als fünf Jahre verschuldet, ein Viertel sogar schon über zehn Jahre. In dieser Zeit steigt der Schuldenberg und schwindet damit die Chance, die Schulden jemals wieder zurückzuzahlen.
Jede siebte Person in der Schweiz ist von Zahlungsrückständen betroffen
In der Schweiz lebt gemäss aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (2023) jede siebte Person in einem Haushalt mit Zahlungsrückständen. Jede 20. Person bzw. 400'000 Personen wurden gemäss Angaben der Wirtschaftsauskunftei CRIF im gleichen Zeitraum sogar betrieben oder hatten ein laufendes Konkursverfahren.
Ob man lernt, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, ein Budget aufstellt und einhält, ist heute weitgehend Glücks- oder Familiensache.
Die Gründe für die Verschuldung sind vielfältig: Sie reichen von einem zu tiefen Einkommen über administrative Überforderung bis hin zu risikoreichem Anlegeverhalten. Häufig aber steht am Anfang einer Überschuldung ein Schicksalsschlag: Eine Krankheit oder ein Unfall, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Trennung, Scheidung oder ein Todesfall bringen die finanzielle Situation aus dem Lot (Lesen Sie hierzu unseren Artikel «Wenn finanzielle Not das Leben bestimmt»).
Die viel zitierte Schuldenspirale beginnt: mit Stress durch Betreibungen und Anwaltsschreiben, den Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt, die Betreibungen oder eine Lohnpfändung mit sich bringen, und neu hinzukommenden Schulden.
Ein erster Schritt: Die Steuern ins Existenzminimum miteinbeziehen
Zu dieser Abwärtsdynamik tragen Kredite bei, die aufgenommen werden, um Betreibungen abzuwenden, aber auch die Tatsache, dass laufende Steuern nicht in die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (BEX) einbezogen werden, das im Falle einer Lohnpfändung ausbezahlt wird.
Die gepfändete Person muss dennoch Steuern auf ihren gesamten Lohn zahlen und häuft automatisch neue Steuerschulden an. Das wird sich bald ändern: Nach der Zustimmung des Parlaments zum Einbezug der Steuern in die Berechnung des BEX muss der Bundesrat nun einen konkreten Gesetzesvorwurf vorlegen.
Laufende Debatte: Eine Restschuldbefreiung einführen
Es ist ein erster politischer Schritt, damit verschuldete Menschen aus der Schuldenspirale herausfinden. Der zweite ist das vom Bundesrat vorgeschlagene Sanierungsverfahren mit Restschuldbefreiung, das im Parlament zur Debatte steht. Dieses sieht vor, dass hoffnungslos verschuldeten Personen nach einer bestimmten Dauer mit Rückzahlungspflicht die Schulden erlassen werden (Abschöpfungsphase).
Heute haben die Klient*innen der Schuldenberatungsstellen über 48% ihrer Schulden beim Staat.
Von einem solchen Schuldenschnitt würden nicht nur die Betroffenen und von ihnen abhängige Kinder und Angehörige profitieren, sondern auch die Gesamtwirtschaft: Ein Neustart ohne Schulden ermöglicht eine Wiederintegration in den Wirtschaftskreislauf, was neben sinkenden Sozial- und Gesundheitskosten auch neue Steuereinnahmen zur Folge hätte.
Eine Überlegung wert: Die Steuern direkt vom Lohn abziehen…
Ein dritter Hebel, damit Menschen gar nicht erst in die Schuldenspirale kommen, wäre ein Direktabzug von Steuern und Krankenkassenprämien vom Lohn. Denn heute haben die Klient*innen der Schuldenberatungsstellen über 48% ihrer Schulden beim Staat: in Form von Steuerschulden, von den Kantonen übernommenen Krankenkassenprämienschulden und Unterhaltsbeiträgen.
…und Finanzbildung in der Volksschule einführen
Neben diesen gesetzlichen Veränderungen könnte eine bessere Verankerung der Finanzbildung in der Volksschule dazu beitragen, dass Menschen gar nicht erst in die Verschuldung geraten. Ob man lernt, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, ein Budget aufstellt und einhält, ist heute nämlich weitgehend Glücks- oder Familiensache.
Zudem bräuchte es einen anderen Diskurs rund um das Thema Geld und Geldprobleme sowie ein Wissen darum, wie man bei kritischen Lebensereignissen nicht nur fragt, wie es der Person geht, sondern auch, wie es ihr finanziell geht. Denn nur wenn das Tabu um Schulden fällt, können sich Menschen früh genug Unterstützung holen und so leichter von der Schuldenlast befreien.
**Zahlen zu den Klient*innen der Schuldenberatungsstellen stammen aus der Statistik der Mitgliederorganisationen von Schuldenberatung Schweiz 2024
Haben Sie Schulden?
Die Caritas Schuldenberatung bietet Rat.
Kommentar
Restschuldbefreiung: Kein Freipass, sondern zweite Chance
Die geplante Einführung eines Sanierungskonkurses mit Restschuldbefreiung (25.019 Änderung SchKG) wirft bei vielen Menschen Fragen auf: Ist es gerecht, dass Schulden erlassen werden können? Fördert das nicht unverantwortliches Verhalten? Die Skepsis ist verständlich – doch ein genauer Blick zeigt: Die Reform ist kein Freipass für ein leichtfertiges Konsumverhalten, sondern ein verantwortungsvoller Schritt zu mehr sozialer Stabilität.
Der Vorschlag ist alles andere als lasch: Er stellt klare Zugangsbedingungen. Wer sich entschulden will, muss über ein stabiles, ausgeglichenes Haushaltsbudget verfügen und darf keine neue Schulden machen. Die Person muss einer Erwerbsarbeit nachgehen (oder sich ernsthaft darum bemühen) und während mehrerer Jahre alle pfändbaren Einkommensteile abgeben. Das heisst, die Restschuldbefreiung wird nur gewährt, wenn sich die betroffene Person im genannten Sinn redlich verhält. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt in der normalen Schuldenhaftung.
Wichtig ist auch: Überschuldung entsteht selten aus Leichtsinn. Meistens sind Krankheit, Scheidung oder der Verlust des Arbeitsplatzes die Auslöser. Ohne eine Perspektive auf Entschuldung bleiben Betroffene dauerhaft blockiert – mit Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft: Arbeitskraft geht verloren, Sozialausgaben steigen.
Eine faire und kontrollierte Entschuldung gibt Menschen die Chance, wieder Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, für ihre Familie und für die Gesellschaft. Die Restschuldbefreiung ist keine Einladung zum Schuldenmachen, sondern ein Zeichen für ein modernes Rechtssystem.
Pascal Pfister, Geschäftsleiter Dachverband Schuldenberatung Schweiz

Dieser Artikel erschien im «Caritas regional». Das Magazin der regionalen Caritas-Organisationen erscheint zweimal jährlich.
Jetzt reinlesen!
Zur neusten Ausgabe